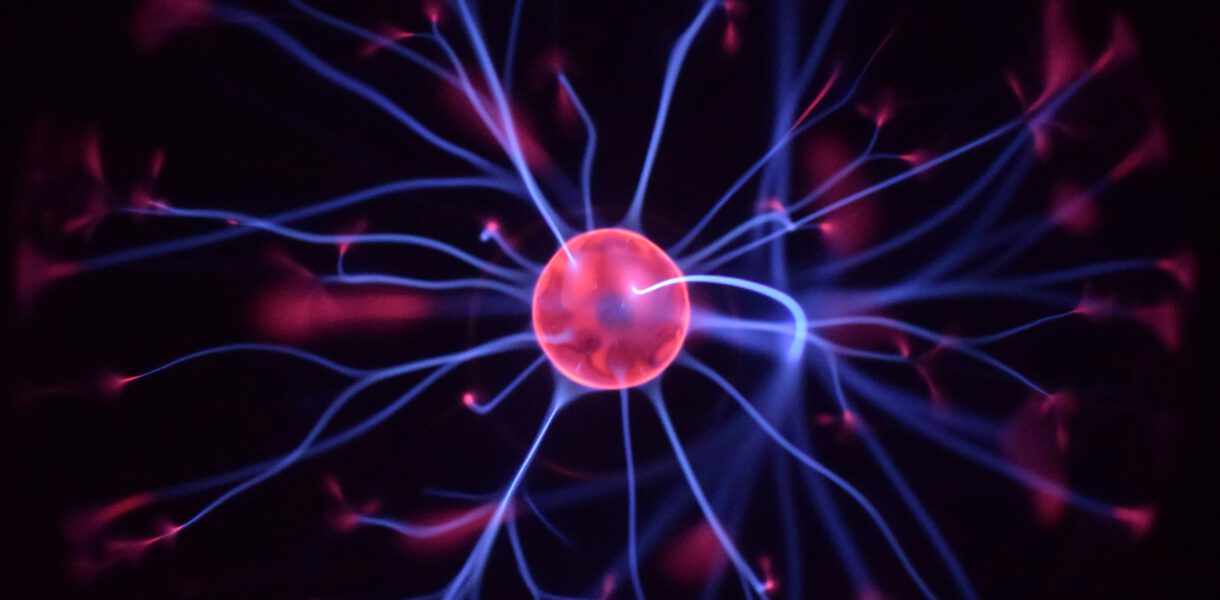Es hakt im Hirn
Im Allgemeinen würde ich sagen, habe ich eine ganz ordentliche Auffassungsgabe, was die deutsche Sprache angeht. Es sei denn, jemand verneint etwas doppelt. Wenn einer also sagt, „sie ließ nichts unversucht“ oder „ich vergesse nicht selten meine Brille“ oder „es stimmt nicht, dass ich es nicht gesagt habe“, wird´s bei mir ein bisschen schwierig. Ja, eine doppelte Verneinung ist wie ein Ja, nur durch eine Art rhetorischer S-Kurve gefahren. Und aus der fliege ich bei höherer Sprechgeschwindigkeit schnell mal raus. Bei Verhandlungen oder Gesprächen wichtiger Natur ein gehöriger Nachteil, der hier nicht unerwähnt (!) sein soll. Es kommt nicht selten vor (!), dass ich die erste Verneinung zunächst mal stoisch hinnehme, um dann langsam den Sachverhalt mit der zweiten Verneinung ins Gegenteil verkehre, um wieder in der beabsichtigten Aussage zu landen. Verlasse dann bei kritischen Punkten zwischenzeitlich den Raum.
Wie geht´s Jupp?
Soweit, so gut. Jetzt kommt die Sache mit den negativen Fragen erschwerend hinzu. „Jupp, geht es dir nicht gut?“ „Nein.“ So, wie geht´s ihm denn jetzt? Wenn Jupp jetzt nicht ergänzt „Es geht mir nicht gut“, dann ist alles offen. Es könnt ihm mit dem „Nein“ ja auch gut gehen. Hängt davon ab, ob sein „Nein“ die verkehrende Wirkung oder die verstärkende Wirkung haben soll. Die verneinende Wirkung von „nein“ kann hier völlig wirkungslos sein, nicht wahr? Nur weil in einer Äußerung zwei Verneinungen auftreten, handelt es sich damit ja wohl nicht automatisch eine doppelte Verneinung mit bejahender Wirkung. Verneinte Elemente, die, wie bei Jupps Antwort, selbständig aneinandergereiht werden („Nein, es geht mir beschissen“), heben sich nicht auf. Auch das Wort „beschissen“ macht es hier nicht besser. Weder für Jupp, noch für mich.
Learning:
War das nicht ein schöner Beitrag? Ja, das war kein schöner Beitrag.